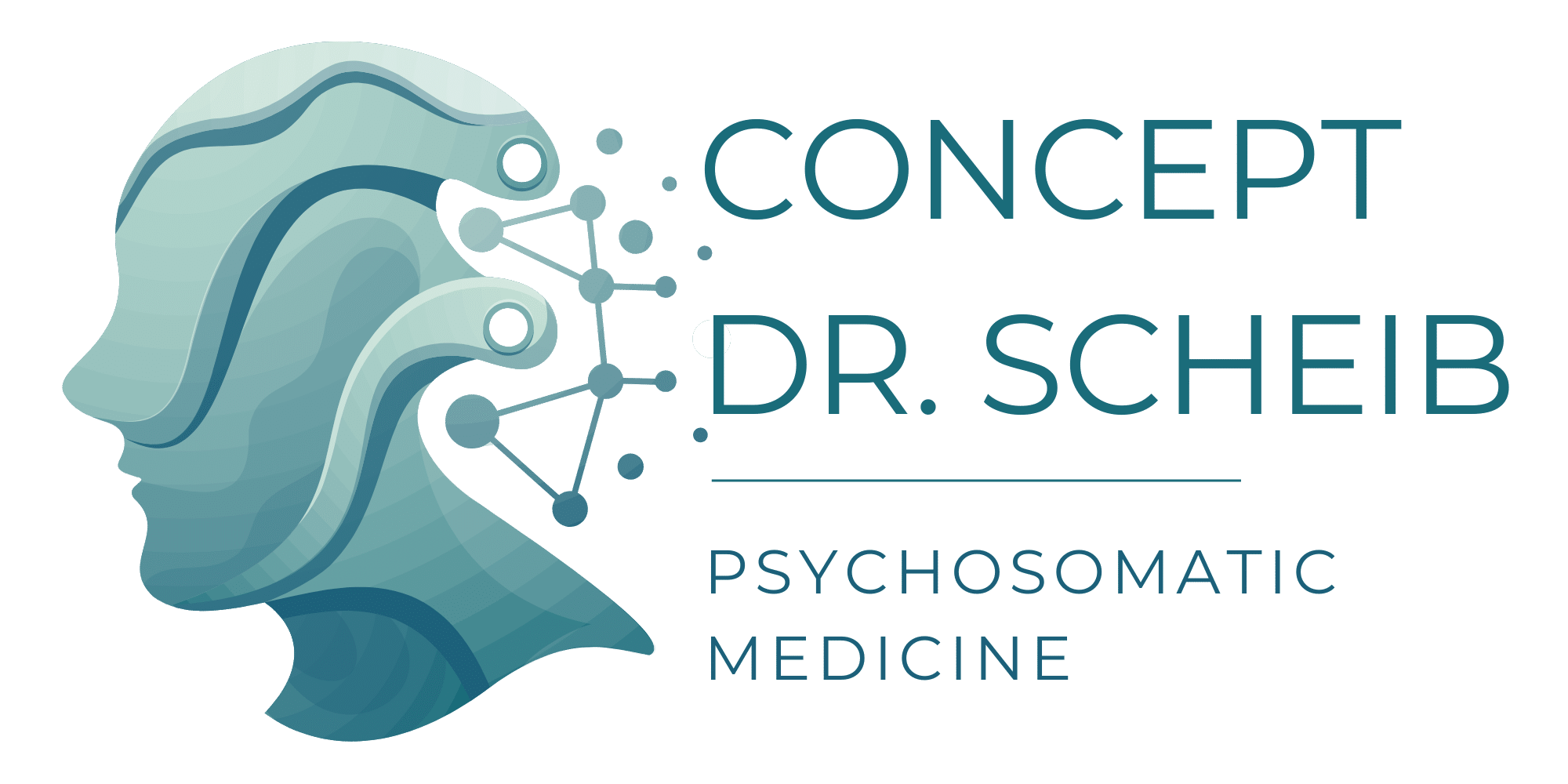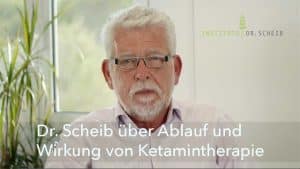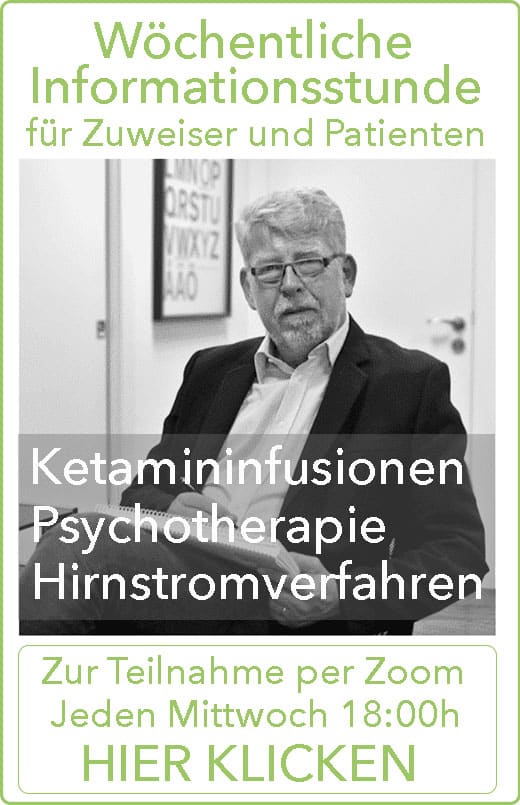Therapie nach Schlaganfall mit Anfang 40
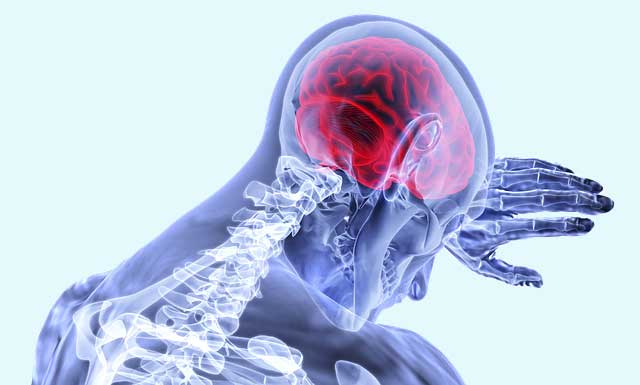
Foto: VSRao
Viele Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, leiden unter bleibenden Beeinträchtigungen. Zu den körperlichen Beschwerden, kommen oft psychische Probleme, die bei einer Therapie nach einem Schlaganfall auch behandelt werden sollten.
Klinischer Fall: Patientin, 42 J., Schlaganfall
Therapie nach Schlaganfall von einer Patientin, die ca. ein Jahr zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Sie stellte sich in meiner Sprechstunde vor da sie auf Grund der körperlichen Einschränkungen und der Einschränkung in ihrer Selbstständigkeit durch den Schlaganfall an Depressionen litt.
Autofahren durfte sie wegen ihrer reduzierten Konzentrationsleistung nicht. Wegen der rechtsseitigen motorischen Einschränkungen brauchte sie Hilfe beim Anziehen, Kochen und anderen alltäglichen Handlungen. Ihren Beruf als Vollzeit-Pflegekraft musste Sie aufgeben.
Besonders belastend war es für sie, externe Hilfe zu akzeptieren. „Ich war immer die, die anderen geholfen hat und jetzt brauche ich Hilfe“. Als selbstständige, aktive und berufstätige Frau plötzlich auf Hilfe anderer angewiesen zu sein, löste Gefühle der Hilflosigkeit, Resignation und Frustration aus. Dies führte zu einer starken Beeinträchtigung ihres Selbstwertgefühls.
Aus der Familie mütterlicherseits waren Depressionen bekannt. Die Patientin hat bereits vor dem Schlaganfall an Depressionen gelitten und war medikamentös eingestellt. Jedoch hatte diese Behandlung zu keiner zufriedenstellenden Verbesserung der Depression geführt.
Unsere Schlagafall-Therapie begann mit einer neurologischen Untersuchung, welche Kontraindikationen für repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) zeigte. So erstellten wir folgenden Therapieplan:
- 6 Ketamininfusionen (2x pro Woche)
- 15 psychotherapeutische Sitzungen.
- rTMS wurde wegen Kontraindikationen ausgeschlossen
Psychotherapie nach Schlaganfall
Zu Beginn war die Patientin davon überzeugt, für eine erfolgreiche Therapie bei Schlaganfall keine psychotherapeutische Hilfe zu brauchen. Es dauerte eine Weile, bis sie diese akzeptierte und damit auch der Empfehlung ihrer Familie folgte.
Zentrales Thema der Psychotherapie war zu Beginn die Annahme des Leidensdrucks: Leidensdruck muss immer ernst genommen, angenommen und akzeptiert werden. Durch eine achtsamkeitsbasierte Exploration und Akzeptanz der Gefühle, entwickelte die Patientin ein besseres Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, mit unangenehmen Emotionen besser umzugehen.
Wichtiger Punkt war außerdem die Identifikation dysfunktionaler Überzeugungen und ein ausgeprägter Perfektionismus, welcher die Patientin überforderte, statt sie dazu motivieren, Aktivitäten durchzuführen.
Ketamintherapie nach Schlaganfall
Ketamininfusionen werden seit einigen Jahren erfolgreich bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt. Die Wirksamkeit von Ketamininfusionen bei Depressionen und anderen psychosomatischen Krankheiten ist wissenschaftlich gut belegt. Lesen sie hier: Medizinische Studien über Ketamininfusionen
Ketamininfusionen fördern die Neuroplastizität, wodurch sich die Patientin stabiler und offener für die psychotherapeutische Arbeit fühlte. So war es möglich, den Ursprung des dysfunktionalen „mussturbatorischen“ Mach-Drangs zu identifizieren und zu verstehen. Sie lernte mittels des verhaltenstherapeutischen Ansatz der ACT (Akzeptanz und Commitmenttherapie) damit anders umgehen.
Parallel wurde die Fähigkeit des positiven Wahrnehmens geschult. Dabei soll der Fokus darauf gelegt werden, auf was der Patient kann, anstatt sich daran festzuhalten, was man nicht mehr kann. Dadurch verbesserte sich das Wohlbefinden der Patientin deutlich.
Nach 6 Ketamininfusionen besserte sich die depressive Symptomatik eindeutig: Die Patientin hatte mehr Energie, konnte wieder Freude und Lust spüren und konnte sogar über möglichen beruflichen Perspektiven nachdenken.
Die Therapie nach dem Schlaganfall ermöglichte es ihr, in Eigeninitiative eine ehrenamtliche Tätigkeit in dem Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hatte zu organisieren. Sie initiierte außerdem eine Selbsthilfegruppe für Schlaganfallpatienten, die sich einmal wöchentlich trifft. Sie gibt damit anderen Schlaganfallpatienten die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen, das auszusprechen, was sie bewegt. Die Patienten können außerdem ihre persönlichen Erfahrungen teilen. Diese Aufgabe führte bei meiner Patientin zu mehr Selbstzufriedenheit und zur Definition einer neuen Identität.
„Ich kann immer noch anderen Menschen helfen, nur anders als vorher“.
Wir empfehlen unseren Patienten die Teilnahme an einer Selbsthilfe-Gruppe, wenn das möglich ist. Informieren Sie sich über das Angebot an Ihrem Wohnort.
In München findet man z.B. die „Selbsthilfegruppe Schlaganfallbetroffener in München e. V.“, mit 127 Mitgliedern zur Zeit eine der grössten Schlaganfall-Selbsthilfegruppen Deutschlands. Website: https://shg-muenchen.de
Therapie nach einem Schlaganfall: Selbsthilfe fördern
Nach 15 Stunden Psychotherapie berichtete die Patientin, dass sie sich noch nicht 100 % von der Depression geheilt fühlt. Jedoch ist sie nun in der Lage sich selbstständig zu helfen.
Ein wichtiger Teil der Therapie nach einem Schlaganfall ist auch die Förderung von Selbsthilfe, um somit das Selbstwertgefühl des Patienten zu steigern.
Wir unterstützen Sie und Ihre Angehörigen gerne in dem Prozess der Krankheitsverarbeitung. Konatktieren Sie uns für ein unverbindliches Vorgespräch. Gerne stehen wir auch zur Klärung weiterer Fragen zu Verfügung.
Sie haben weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich
Egal, ob Sie an einer Behandlung für sich selbst oder für einen Angehörigen interessiert sind, oder ob sie als überweisender Arzt weitere Informationen wünschen: gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie uns einfach:
Hier finden Sie uns:
Privatpraxis in München:
Privatpraxis in Berlin:
Klinik in Palma de Mallorca:
Fakten und Daten zum Schlaganfall
Die Patientin gehört zu den jährlich schätzungsweise 10.000 bis 40.000 Menschen in Deutschland, die schon im jüngeren Alter einen Schlaganfall erleiden.
- Jährlich erleiden etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall, 70.000 davon zum wiederholten Mal.
- Ca. 1,6 Millionen Menschen leiden an den Folgen dieser Erkrankung. Nach den Herzerkrankungen und Krebserkrankungen liegt der Schlaganfall auf Platz 3 der Todesursachen.
- In den ersten 30 Tagen nach einem Schlaganfall versterben 6,8 Prozent der Patienten.
- Etwa die Hälfte der überlebenden Patienten sind schwerbehindert und dauerhaft auf Pflege und Unterstützung angewiesen.
- 25 % aller Schlaganfall-Patienten sind jünger als 65 Jahre und befinden sich somit im erwerbstätigen Alter
- Das Risiko, innerhalb von 5 Jahren einen erneuten Schlaganfall zu erleiden, liegt bei ca. 20 %.
Sowohl die Sterblichkeit als auch die Wahrscheinlichkeit, nach einem Schlaganfall eine bleibende Behinderung zu erleiden, hängt vom Schlaganfall-Typ ab: nach Blutungen versterben im ersten Jahr fast 60 Prozent der Betroffenen, nach Hirninfarkten weniger als 30 Prozent. Andererseits ist die Chance, nach einem Hirninfarkt ein selbstständiges Leben führen zu können, für Patienten, die rechtzeitig behandelt werden können, deutlich höher.
In den vergangenen 25 Jahren wurden bei der Behandlung von Schlaganfällen große Fortschritte erzielt. Durch die Einführung der Stroke Units und die invasive Akuttherapie durch die Thrombolyse und Thrombektomie konnte die Prognose verbessert und die Sterblichkeit deutlich reduziert werden.
Dennoch zählen Schlaganfälle noch immer zu den häufigsten Ursachen von körperlichen Behinderungen, geistigen und seelischen Störungen.
Quelle: https://schlaganfallbegleitung.de
Informationen von Verbänden
F.A.Q. Schlaganfall
Ein Schlaganfall wird meist durch den Verschluss einer Arterie im Gehirn ausgelöst. Das führt dazu, dass die Nervenzellen im Gehirn zu wenig Blut und Sauerstoff zugeführt bekommen. Manchmal kann die Ursache des Schlaganfalls auch eine Hirnblutung sein, die durch ein eingerissenes Gefäß im Hirn entsteht.
Wichtige Ursachen für einen Schlaganfall können sein:
- Bluthochdruck
- Vorhofflimmern
- Diabetes mellitus
- Fettstoffwechselstörungen
- Rauchen
- Alkohol
- Übergewicht
- Bewegungsmangel
Die genauen Folgen eines Schlaganfalles sind abhängig davon, welcher Teil des Gehirns von dem Schlaganfall betroffen ist. Bei ca. zwei Drittel der Überlebenden bleibende körperliche und seelische Beeinträchtigungen zurück. Viele der Betroffenen benötigen permanente Betreuung.
Weitere Folgen können sein:
- Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einen erneuten Schlaganfall zu erleiden.
- Orientierungsstörungen
- Persönlichkeitsveränderung
- Depression
- Lähmungserscheinungen
- Einschränkungen in der räumlichen Wahrnehmung
- Sprachstörungen oder Sprachverlust
- Unkontrollierte Bewegungen
- Sehstörungen